
Leichtbau für Perrondächer
Am Bahnhof Menznau hat die BLS erstmals Solarmodule auf ein bestehendes Perrondach montiert. Die Installation ist ein Pilotprojekt, das die Möglichkeiten und Herausforderungen von Photovoltaik auf bestehenden Strukturen untersucht. Denn: Perrondächer sind zwar vorteilhafte Flächen für Sonnenenergie, jedoch nicht für schwere Solarmodule konstruiert. Deshalb musste sich die BLS etwas einfallen lassen. Die Solarmodule wurden auf eine Unterkonstruktion aus Kunststoff montiert, die direkt auf die Abdichtung des Perrondachs geschweisst wurde. Die Lösung wurde unter Federführung der Abteilung Hochbau der BLS erarbeitet, in Zusammenarbeit mit der Bauder AG, der Lieferantin der Unterkonstruktion, sowie dem Photovoltaikspezialisten Clevergie, der die Anlage geliefert und installiert hat.
Diese Methode vermeidet zusätzliche Lasten und bringt Vorteile in Bezug auf die langfristige Haltbarkeit und Effizienz der Anlage. Das neue Solarsystem wird nun während zwei Jahren ausführlich getestet. Sollte sich die Lösung bewähren, plant die BLS, ähnliche Installationen auf weiteren Perrondächern umzusetzen.

Potenzial für 6'000 Haushalte
Neben Perrondächern identifiziert die BLS auch andere Flächen für die Installation von Photovoltaikanlagen. Dazu gehören bestehende Gebäude wie Werkstätten, Bahnhofsgebäude mit den entsprechenden Dachflächen, Parkplatzüberdachungen sowie Tunnelportale oder Brücken. Darüber hinaus eignen sich auch Neubauten wie kleinere Technikgebäude an Bahnhöfen oder grosse Gebäude wie etwa die Werkstätte Oberburg. «Alleine die BLS-eigenen Dachflächen bieten ein Potenzial von über 100'000 Quadratmetern», erklärt André Guidi, Leiter des Kompetenzzentrums für Photovoltaikanlagen bei der BLS. «Nutzen wir diese Flächen voll aus, könnten wir Strom für insgesamt rund 6’000 Haushalte produzieren. Das entspricht der Versorgung einer mittelgrossen Gemeinde wie Lyss.» Bereits umgesetzt sind 24 BLS-eigene Dächer auf 20 Gebäuden – und eben ein Perrondach.
In der Realität kann das theoretische Potential jedoch nicht vollständig ausgeschöpft werden. Gründe dafür gibt es viele: Zustand und Ausrichtung der Dächer, Statik, Beschattung, zu wenig Eigenverbrauch. «Deshalb legen wir grossen Wert darauf, dass beim Bau von neuen Gebäuden geprüft wird, ob eine PV-Anlage realisiert werden kann», erklärt Guidi. Beim Bauen in der Nähe von Bahnstrecken sei eine Nachrüstung aufgrund der Sicherheit sehr herausfordernd. Künftig würden auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie das Contracting geprüft, so der Experte weiter. Beim Contracting handelt es sich um ein Modell, bei dem ein Dienstleister die Planung, Finanzierung, Installation und den Betrieb einer Photovoltaikanlage übernimmt. Der Gebäudeeigentümer – in diesem Fall die BLS – stellt lediglich die Dachfläche zur Verfügung und profitiert im Gegenzug von günstigem Solarstrom.
Bald 100% erneuerbar?
André Guidi und sein Team sind derzeit daran, herauszufinden, welche Flächen für Photovoltaikanlagen in Frage kommen. Dies hängt unter anderem von der Dachstatik, dem Landschaftsbild oder der Verschattung durch umliegende Gebäude ab. Im Fokus stehen Flächen für Anlagen von mindestens 500 Quadratmetern und einem hohen Eigenverbrauch. «Grössere Anlagen sind effizienter und wirtschaftlicher, was die Rentabilität der Photovoltaikprojekte erhöht, sofern wir den erzeugten Strom zu einem grossen Teil selbst verbrauchen können», erklärt Guidi. Und schon jetzt ist klar: Das Potenzial ist gross. Entsprechend ambitioniert ist auch das Ziel der BLS: Sie prüft, ob bis 2040, der gesamte 50-Hertz-Strom, also der Haushaltstrom (siehe Box), aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden kann.Ein wegweisender Schritt
In Menznau lichten sich die Nebelschwaden, die zäh an den Hügeln klebten, und lassen endlich die Sonne durchscheinen auf die Photovoltaikanlage auf dem Perrondach. Und auch Reto Brunner macht sich davon – ins Technikgebäude, dorthin, wo das Herz der Anlage beheimatet und ob der hunderten Kabel der Laie heillos überfordert ist. Hier sorgt Reto Brunner dafür, dass die Lampen, die Anzeigen und die Billettautomaten am Bahnhof mit Sonnenenergie aus den Solarmodulen vom Perrondach gespiesen werden. Ein weiterer wegweisender Schritt hin zu einer nachhaltigeren Zukunft.Jede/r kann ein Elektrizitätswerk sein
Das Hertz schwingt
-
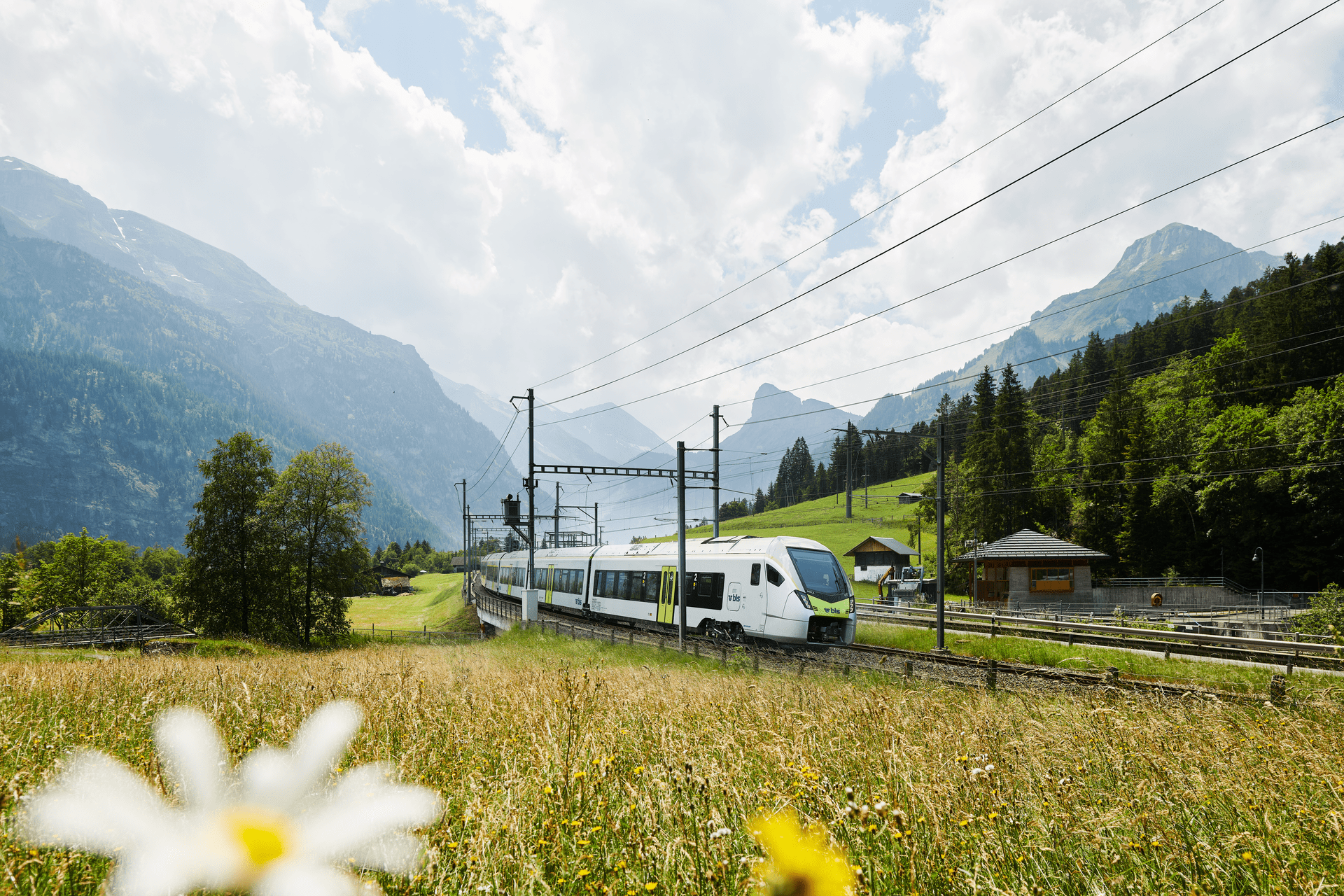
Der neue Nachhaltigkeitsbericht ist da
Die Photovoltaikanlage in Menznau ist ein Beispiel für das nachhaltige Engagement der BLS. Die zahlreichen und vielfältigen Themen finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht. Er zeigt die Massnahmen der BLS für eine nachhaltige Zukunft. Im Bericht sind die aus der Sicht des Unternehmens wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen beschrieben, sie erfahren, wie sich die CO2-Emissionen der BLS verändert haben und welche Chancen aber auch Herausforderungen uns begegnen. Zudem bietet der Bericht Beispiele aus dem BLS-Alltag, die konkrete Handlungen aus dem Jahr 2024 beleuchten.Verantwortung


